Folge 22: Prof. Annette Leßmöllmann
Annette Leßmöllmann ist Professorin für Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Linguistikist am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und lehrt u.a. in den Bachelor- und Master-Studiengängen „Wissenschaft – Medien – Kommunikation“.
1. Wie unterstützt die neue Infrastruktur des InformatiKOM die Ausbildung von Wissenschaftskommunikator:innen im Studiengang „Wissenschaft – Medien – Kommunikation“?
Die Architekten haben nicht zu viel versprochen: Das InformatiKOM ist ein kommunikatives Gebäude. Es bringt uns alle mehr ins Gespräch, ermöglicht gemeinsames Arbeiten, projektbezogenen Austausch und durch viele Lernplätze auch das konzentrierte Arbeiten alleine. Unsere Studierenden genießen es, einen Ort am Campus zu haben, der „Kommunikation“ im Namen trägt und ihnen damit sagt, dass der Ort für sie und ihre Themen da ist. Sie fühlen sich dadurch, nach meiner Erfahrung, am KIT mehr willkommen. Die Seminarräume erlauben flexibles Lernen und Arbeiten, weil man das Mobiliar schnell für Gruppenarbeiten umstellen kann. Außerdem lassen die Audio- und Videostudios für unsere praktischen Lehrveranstaltungen die Augen der Lehrbeauftragen leuchten: Sie haben es mit aktueller Technik zu tun, wenn sie z. B. Podcasts mit den Studierenden produzieren. Zudem können wir unkompliziert und niederschwellig Videoimpulse und -vorträge aufnehmen. Das unterstützt die hybride Lehre – die sich unsere Studierenden wünschen – ganz wesentlich.
2. Angesichts des ständigen Wandels in der Kommunikation: Welche aktuellen Trends sehen Sie in der Wissenschaftskommunikation, und in welche Richtung könnte sich das Forschungsfeld künftig entwickeln? Wie bereiten Sie Ihre Studierenden darauf vor?
Das Thema „Wissenschaftsfreiheit“ ist massiv auf der politischen Agenda und wird es auch für die Wissenschaftskommunikation bleiben. Wissenschaftskommunikation wird also politischer, was eine Herausforderung darstellt, da sie ihre Legitimation häufig daraus zieht, neutrale Evidenz zu vermitteln. Was heißt „neutral“, wenn Wissenschaftszweige Förderung verlieren, Daten unterdrückt und öffentliche Plattformen abgeschaltet werden, wie es derzeit in den USA passiert? Das wird ein wichtiger Schwerpunkt, auch in der Lehre. Da wir in der Forschung an verschiedenen Lehrstühlen zu Moralisierung, Politisierung und Polarisierung forschen, sind wir hier für die forschungsorientierte Lehre gut aufgestellt. Zudem setzen wir auf Diskurs und Argument, insbesondere im interaktiven Austausch mit den Studierenden.
Ein zweiter wesentlicher Trend ist der Umgang mit KI. Die Wissenschaftskommunikation ist hier auf vielen Ebenen herausgefordert (und diese Themen werden gerade von einer Task force „KI und Wissenschaftskommuniktion“ im Rahmen der #factoryWisskomm des BMBF bearbeitet, in der ich mitarbeite): Von der verantwortungsvollen KI-Nutzung, die auf Wahrheitsbezug und Glaubwürdigkeit setzt, bis hin zu der Frage, ob KI-Anwendungen die Wissenschaftskommunikation als Berufszweig nicht teilweise ersetzen könnten. Auch bezüglich der Frage, wie ein KI-manipulierter öffentlicher Diskursraum der Wissenschaftskommunikation schaden kann – hier schließt sich übrigens der Kreis zum ersten Punkt, dem Angriff auf Wissenschaft und Evidenz durch eine unheilige Allianz zwischen manipulativer KI- und Social Media-Nutzung. Wir greifen das in vielen Lehrveranstaltungen auf, und die Herausforderung wird sein, eine gute Gewichtung im Lehrangebot zu finden. Ein Thema, das mir – und ich wage zu sagen, uns allen im Department Wissenschaftskommunikation – z. B. sehr am Herzen liegt, ist das Thema Wissenschaftsjournalismus, der zum einen durch KI und zum anderen durch immer stärkere Kürzungstrends, auch und gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien, stark herausgefordert ist.
Ein dritter Trend ist eher eine Frage: Wie geht es nach einer sehr fruchtbaren Phase der Forschungsförderung für die Wissenschaftskommunikation nun weiter? Das BMBF hatte eine Förderlinie für Wissenschaftskommunikation, in der meine Kollegin Senja Post und ich erfolgreich Projekte eingeworben habe. Ein anderes Beispiel: Unser RHET AI Center, das Forschung und Transfer zum öffentlichen Diskurs über KI untersucht, wird von der VolkswagenStiftung unterstützt; es ist eines von vier Zentren dieser Art in Deutschland. Das Thema Wissenschaftskommunikation ist also in der Forschungslandschaft, aber auch in vielen öffentlichen Diskursen bis hin in Politik und Verwaltung angekommen – auch und schon lange in Hochschulen, deren Kommunikation ich in mehreren Projekten erforscht habe bzw. noch erforsche. Meine Analyse: Wir sind jetzt in einer Konsolidierungsphase, könnten also vielleicht einfach weitermachen wie bisher, aber gleichzeitig sind wir in einer Phase, in der es um ganz fundamentale Dinge geht: Wird der Journalismus noch weiter entmachtet (s. die USA, wo Donald Trump Medienkritik für „illegal“ erklärt)? Wird die öffentliche Debatte noch mehr politisiert und emotionalisiert, so dass Fakt und Argument immer weniger zählen? Wie geht man damit um, dass manche (und nicht wenige) Menschen in ihren eigenen Informationswelten leben und Wissenschaftskommunikation für „woken Quatsch“ halten? Wissenschaftskommunikation wird also immer häufiger aufgerufen sein, sich über die Infrastrukturen Gedanken zu machen, die eine rationale Kommunikation über Wissenschaft möglich macht. In einem toxischen Social-Media-Umfeld lässt sich evidenzorientierte Kommunikation kaum bewerkstelligen. Deshalb haben viele Forschungsorganisationen X verlassen. Und ein zusammengekürzter Journalismus kann weniger über Forschung berichten. Welchen öffentlichen Diskursraum wollen wir also alle haben, und wie gestalten wir ihn? Hier ist jede:r in der Wissenschaftskommunikation – und ich finde, eigentlich jede Bürgerin und jeder Bürger – gefragt, sich konstruktiv einzubringen. Das sind wichtige Themen, die ich in meinen Lehrveranstaltungen gerne mit den Studierenden diskutiere.
3. Was sind die Grundpfeiler der Wissenschaftskommunikation, die in allen Medien konsistent umgesetzt werden sollten?
Ein wichtiges Ziel der Wissenschaftskommunikation ist es, Menschen überhaupt erstmal zu erreichen. „Ich habe hier ganz tolle Forschung, da setz ich doch mal ein Podcast auf“, ist ein ehrenvoller Ansatz, bringt aber nichts, wenn niemand den Podcast hört. Immer erstmal herausfinden, was die Userinnen und User wollen, was sie umtreibt, wo ich sie erreiche und was ich eigentlich von ihnen will, muss jede:r in der Wissenschaftskommunikation – ob Journalistin, Museumskurator, Podcasterin, Influencer oder PR-Strategin – immer erstmal bedenken, bevor er oder sie irgendetwas in die Welt setzt. Das heißt nicht, dass man seinen Hörerinnen oder Usern nach dem Mund redet. Aber man muss den „sweet spot“ herausbekommen, mit welchen Themen, Aufhängern oder Orientierungsangeboten ich ihre Aufmerksamkeit bekomme – und behalte. Dann kann ich auch Informationen vermitteln, von denen niemand im Traum gedacht hätte, dass sie für ihn oder sie relevant sein könnten.
Zudem sollte Wissenschaftskommunikation nicht nur faktenorientiert und rational kommunizieren, sondern auch deutlich machen, dass man in seinem Leben und in der Demokratie nur weiterkommt, wenn man sich mit Tatsachen beschäftigt und nicht mit Wunschvorstellungen. Ich glaube, dass Tatsachen und logische Schlussfolgerungen etwas sehr Relevantes für das Leben und die Gesellschaft sind, denn wer sich von ihnen verabschiedet, schwimmt nur noch in Emotionen und irrationalen Annahmen und niemand wird mehr dafür verantwortlich gemacht, Falsches zu sagen. Was das heißt, zeigt sich derzeit auch in den USA, wo ein Impfgegner Gesundheitsminister ist – und das kann Leben kosten.
Übrigens heißt „tatsachen- und faktenbezogen“ nicht, trocken zu kommunizieren. Werte, Emotionen, Identitäten müssen auch Teil der Kommunikation sein, anders geht es im heutigen Kommunikations-Ökosystem nicht mehr. Die Balance zu finden und nicht im falschen Moment Fakten außer Acht zu lassen und der Emotion den Vortritt zu geben – das ist die Kunst.
Dritter Punkt: dialogfähig sein. Es gibt sehr gute Debatten unter Instagram-Posts oder YouTube-Kanälen – und die muss man führen können.
4. Der Austausch mit der Gesellschaft ist eine Aufgabe, die das InformatiKOM für das KIT leisten soll. Welche Chancen sehen Sie für Ihr Institut und den Studiengang WMK, aktiv dazu beizutragen?
Wir nutzen das Foyer des InformatiKOM, um mit der Öffentlichkeit in Austausch zu treten: Erst kürzlich konnten wir die Sozioinformatikerin Katharina Zweig für einen Abendvortrag gewinnen; sie hat über die Frage referiert, ob Sprachmodelle eher Superhumans oder Plappernde Papageien sind. Damit hatten wir ein tolles Thema, das die Disziplinen im Haus miteinander verbindet. Einige, die gerade im InformatiKOM unterwegs sind oder lernen, hören zufällig zu und bekommen die Anknüpfungspunkte unserer Forschung mit. Anfang April laden wir Bürgerinnen und Bürger für eine Unterhausdebatte ein: Prof. Dr. Hennig Lobin (Leiter Leibniz-Institut für Deutsche Sprache) wird eine wissenschaftliche Einordnung zum Thema „Haben wir nichts Besseres zu tun? Sprache, Gender und Wissenschaft in der Zeitenwende“ geben, und danach wollen wir zum polarisierenden Thema „gendergerechte Sprache“ gemeinsam in die Diskussion kommen und die verschiedenen Positionen ausloten. Auch unsere Weihnachtsvorlesung und -feier fand im Foyer statt; der offene Raum ist nicht nur für Vortragende beeindruckend, auch Studierende und Gäste fühlen sich wohl und kommen gerne wieder. Im dritten Stock profitieren wir außerdem von einer der tollen Dachterrassen; dort treffen wir uns bei gutem Wetter zum Projektaustausch mit unseren Partnern von anderen Forschungsinstitutionen, aber auch mit Studierenden und Alumni.
5. Zum Schluss noch eine „persönliche“ Frage: Wie nutzen Sie generative KI? Gibt es spezifischen Anwendungen oder Tools, die sich als besonders hilfreich erwiesen haben?
Ich nutze KI (natürlich mit aller gebotenen Vorsicht) für die Recherche, z. B. mit Research Rabbit oder Consensus. Manchmal verwende ich Microsoft Copilot oder ChatGPT, wenn ich in einem Gedankengang feststecke und um meine Überlegungen zu sortieren, im Dialog zu brainstormen. Das ist häufig lustig und anregend, auch wenn ich die Vorschläge meines Gegenübers nicht übernehme. Einige Anwendungen bringe ich in Übungen mit meinem Studierenden ein, um etwas auszuprobieren und dann zu reflektieren, z. B. Tools für die Bildgenerierung, für Podcast-Erstellung oder auch für Drehbücher. Ich nutze die KI also, um didaktisch orientiert über die Nutzung nachzudenken und mir (und damit auch den Studierenden) deutlich zu machen, wohin sich z. B. Large Language Models entwickeln.
Für meine eigenen Texte, also für die schriftliche Linearisierung von Gedanken, nutze ich KI nicht. Auch nicht bei Social Media-Posts. Ich bin so mit meinem Schreiben verwachsen – es gehört in gewisser Weise zu meiner Identität, so zu schreiben, wie ich schreibe, dass ich diesen Schritt bislang nicht tun wollte. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt, wenn ich ihn doch mal tue. Ich habe allerdings ein bisschen mit Detecting-AI experimentiert, weil ich dachte, dass mich das in Krimi-Schreiblaune bringen könnte. Die Ergebnisse fand ich aber etwas lahm. (Vermutlich muss man den Krimi doch selbst schreiben, but who’s got the time).

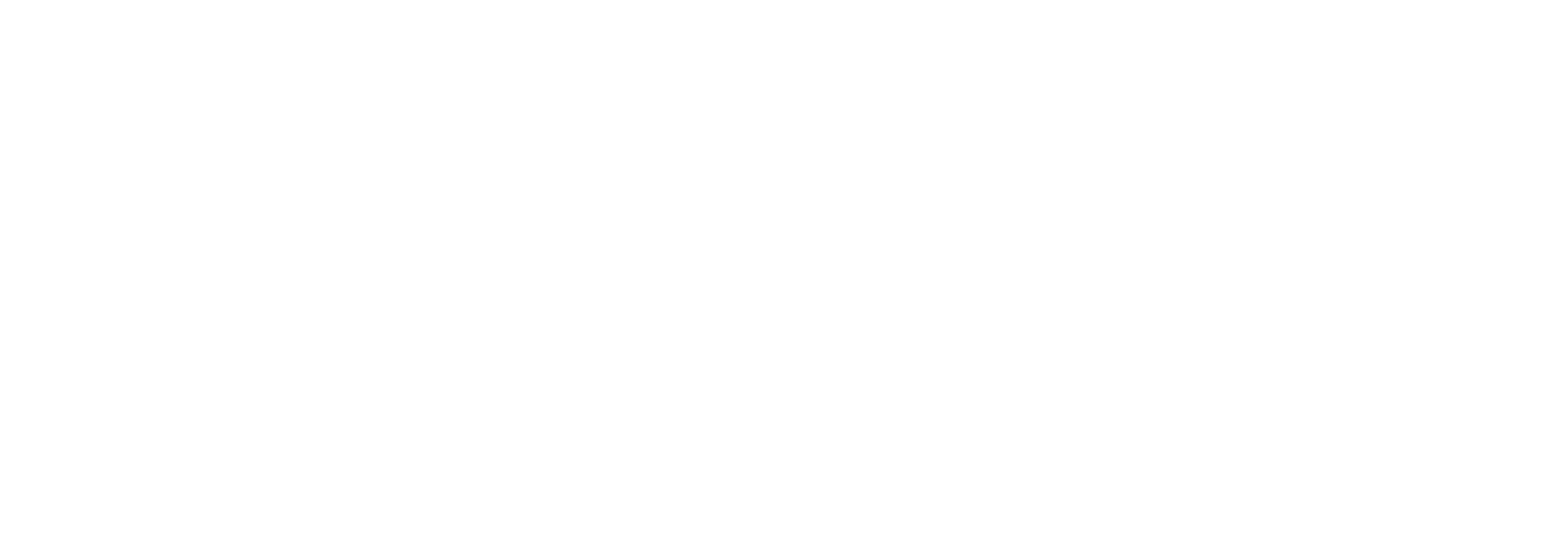
%20KIT%20Breig.jpg)